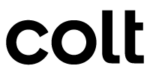Sprechende Stromzähler, Kühlschränke und Busse erobern unsere Welt. Und das ist erst der Anfang. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts werden laut der Plattform „Innovative Digitalisierung der Wirtschaft“ im Nationalen IT-Gipfel rund fünfzig Milliarden Gegenstände mit dem Internet verbunden sein. Sie kommunizieren über das Netz mit Menschen und anderen Gegenständen. Das verändert unseren Alltag und die Städte, in denen wir leben. Der Fachbegriff für diese Entwicklung lautet Smart City und ist das internationale Wort für die Vision einer digital vernetzten Stadt. Die digitale Vernetzung soll die Lebensqualität, Wirtschaft und Zukunftsfähigkeit von Städten verbessern und negative Folgen der Urbanisierung mindern oder vermeiden. Was heißt das konkret?
In Berlin fahren schon heute zahlreiche intelligente Autos und Busse durch die Straßen. Sie teilen ihre Positions- und Betriebsdaten mit anderen Fahrzeugen oder Unternehmen. Diese Daten könnten allen Verkehrsteilnehmern zugänglich gemacht werden. Hinweise auf Staus, freie Parkplätze oder den Öffentlichen Personennahverkehr könnte den Verkehrsfluss beschleunigen. Weitere Anwendungsbeispiele sind intelligente Energienetze, effizientere Verwaltungsprozesse durch elektronische Akten oder die Verbesserung des Zugangs zur Bildung durch E-Learning.
„Informations- und Kommunikationstechnik“- (ITK) sowie Daten-Infrastrukturen sind das technologische Rückgrat einer Smart City. Große Datenbestände und deren Analyse bilden die Basis für die Leistungsfähigkeit einer intelligenten Stadt. Datenerfassung, -verarbeitung, -übermittlung, -analyse und -sicherheit stehen deshalb im Zentrum von Digitalisierungsaktivitäten. „Die Herausforderungen neuer Datenströme werden wir nur bewältigen, wenn wir flächendeckend die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür schaffen. Über feste und mobile Netze müssen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Zugriff zum Internet erhalten. Auch die zunehmende Kommunikation der Rechner untereinander und der vermehrte automatisierte Datenaustausch erfordern zunehmend leistungsfähigere Netze“, schreibt die Bundesregierung in ihrer Digitalen Agenda 2014 – 2017.
„Deshalb ist es extrem wichtig, dass die Verantwortlichen in Städten sich dafür stark machen, dass Hochgeschwindigkeitsnetze, zum Beispiel Glasfasernetzwerke, verlegt und mehr Mobilfunkmasten installiert werden“, sagt Aaron Partouche von Colt. „Die Regulierungsbehörden spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Verbindungsstandards. Sie müssen den Druck auf Mobilfunkanbieter erhöhen, um die Entwicklung von Smart Cities zu beschleunigen. Es ist außerdem wichtig, dass Mobilfunk- und Netzwerkanbieter zusammenarbeiten, um die Smarty City möglichst schnell Realität werden zu lassen.“
Noch mehr Hintergründe zu dem Thema finden Sie in dem englischsprachigen Artikel „What is limiting smart city deployment in Europe?“ von Aaron Partouche. Der Text erschien erstmalig auf techcitynews.com.